Harun Farockis AUFSCHUB (2007) und der „Westerborkfilm“
von Fabian Schmidt
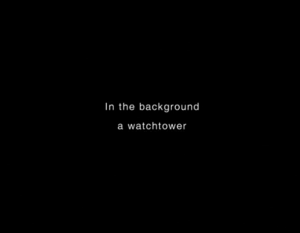

Harun Farocki, Aufschub [Respite], 2007
Der Filmhistoriker Fabian Schmidt wurde 2024 an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF mit einer umfangreichen Studie zur Verwendungsgeschichte des sogenannten Westerborkfilms promoviert. Kurz darauf erschien seine Dissertation als Der Westerborkfilm. Bilderwanderung und Holocausterinnerung in der edition text + kritik in München, als Band 6 der von Chris Wahl herausgegebenen Reihe „Filmerbe“ und als open access-Publikation online zugänglich. Im Folgenden dokumentieren wir einen Abschnitt (S. 390-397), der sich erstmals quellenkritisch mit Harun Farockis Aufschub aus dem Jahr 2007 beschäftigt, einem Film, der für die Rezeptionsgeschichte des „Westerborkfilms“ und allgemein für den Diskurs zur Beziehung zwischen Dokumentarfilm, Geschichtsschreibung und (digital) visual history schnell von großer Bedeutung wurde.
Als „Westerborkfilm“ wird eine Montage von Filmmaterial bezeichnet, das im Frühjahr 1944 im Durchgangslager Westerbork in den deutsch besetzten Niederlanden entstand. Wie Schmidt schreibt, liegt das in Westerbork gedrehte Material „heute zum einen als montierter Film vor, zum anderen als kaum bearbeitetes Negativmaterial. Dieses Negativmaterial ist ein Teil des in der montierten Filmfassung verwendeten Materials in roher Form“ (S. 15). Schmidt kommt zu dem Schluss, dass nicht zweifelsfrei zu ermitteln sei, wer den „Westerborkfilm“ tatsächlich gedreht und montiert habe: „Eine gründliche Analyse der vorhandenen Dokumente demonstrierte, dass es abgesehen von der Zeugenaussage des Lagerkommandanten Gemmeker vor Gericht kaum Belege gibt, die die inzwischen als Allgemeinplatz gehandelte Urheberschaft des Lagerfotografen Rudolf Breslauer stützen. Es ist möglich, dass verschiedene Internierte, darunter Abraham Hammelburg, und sogar SS-Männer die Kamera bedient haben, jedoch immer unter der direkten oder durch Beauftragte vermittelten Überwachung des Lagerkommandanten. Der Westerborkfilm erscheint so als das Ergebnis der Weisungen des Kommandanten Gemmeker und nicht als Projekt der Internierten. Anders als oft behauptet liegen die Aufnahmen nicht nur als Rohmaterial vor.“ (S. 442) Auch die teilweise erheblichen editorischen Bearbeitungen des Materials in der Montage seien nur annäherungsweise zu datieren und Personen zuzuschreiben. Fabian Schmidt unterstreicht, dass die Aufnahmen aus Westerbork „keine unverstellten Dokumente des Lagerlebens und somit quasi-objektiv“ seien, „viele der Aufnahmen sind inszeniert, und im eigentlichen Sinne freiwillig nimmt niemand teil“ (S. 443).
Wir danken Fabian Schmidt und der edition text + kritik für die Erlaubnis, diese wichtige Diskussion von Aufschub hier als Auszug vorzustellen.
2007 veröffentlicht Harun Farocki Aufschub, einen 40-minütigen, stummen Essayfilm, der nur aus Westerborkmaterial und kommentierenden Texttafeln besteht. Obwohl die Veröffentlichung erst knapp 17 Jahre her ist, hat sich seitdem die Zahl der Trägerfilme mit Westerborkmaterial verdoppelt. Der Erfolg von Aufschub und die damit verbundene Öffentlichkeit für das Filmgedächtnis des Westerborkfilms haben wahrscheinlich einen gewissen Anteil an dieser Entwicklung. War die Herkunft des Westerborkmaterials außerhalb der Niederlande bis dahin vor allem Insidern bekannt, und das Bild der Settela eine Holocaustikone, die allerdings kaum jemand einem Archivmaterial zuordnen konnte, wächst seine Bekanntheit nun innerhalb kurzer Zeit sprunghaft. Mit Aufschub gibt Farocki dem Material vor allem einen Namen und eine kontextualisierende Geschichte. Dessen gleichzeitige Bedeutsamkeit und Unbekanntheit gründet sich auf seine Funktion bei der Formierung der Holocausterinnerung in den 60 Jahren zuvor. Der Westerborkfilm überwindet durch Farockis Kontextualisierung schlagartig den Status eines nicht-ikonischen Materials. Zwar erreicht auch durch Aufschub keine der Einstellungen eine vergleichbare Bekanntheit wie das Bild der Settela, jedoch rückt Farocki die Bilder vom Bahnsteig weiter in die Peripherie der Ikonizität. Quasi-ikonisch sind die Szenen vom Bahnsteig jedoch nicht nur, weil Farocki sie verwendet, sondern weil sie längst zu einem, wenn auch oft nicht erkannten oder zugeordneten Symbol für die mitfühlende Holocausterinnerung und somit über ihre ritualhafte Wiederverwendung hinaus virulenter Bestandteil dieses immer wieder erneuerten Gedächtnisses geworden sind.
Mit der intensiven Nutzung des Westerborkmaterials in Aufschub gelingt es Farocki nicht nur, einen Verbindungskanal zwischen Archivsystem und medialer (Kunst-)Öffentlichkeit zu legen, sondern er stellt es zusätzlich in einen neuen Rezeptionszusammenhang. Das Material erscheint bei ihm weder als Beweis, wie bei den Prozessen gegen Eichmann, Gemmeker und Rauter, noch als illustrierendes, ein Geschichtsbild mitgestaltendes Material in einer dokumentarfilmischen Erzählung. Farocki macht den Westerborkfilm stattdessen zum Gegenstand einer ästhetischen Wahrnehmung. Diese Ästhetisierung ist keine magische Verwandlung der Holocaustbilder in Kunst, vielmehr nutzt Farocki die in das Material eingeschriebenen Widersprüche und seinen Status als gleichzeitig subkutane (teils ungezeigte, aber vor allem nicht entschlüsselte) und ikonische visual history des Holocaust, und macht so die Wahrnehmungsmodi zum eigentlichen Gegenstand seiner Präsentation. Inwiefern handelt es sich bei Aufschub also um Kunst, oder anders gefragt: Wie erzeugt Farocki die ästhetische, zwischen unterschiedlichen Prädikationen changierende Wahrnehmung, die Aufschub zu einem Kunstfilm macht? Der Regisseur schlägt seinem Publikum in Aufschub den Westerborkfilm als Gegenstand einer investigativen Recherche und Reflexion vor. Das für die Geschichtsbilder des Holocaust konstitutive und in Teilen ikonische Material wird also untersucht. Damit wiederholt Farocki zunächst nur einen Prozess, der sich mehr als ein Jahrzehnt vorher in den Niederlanden abgespielt hat – die Untersuchung des Materials und die Suche nach Settela –, mithin ein Prozess, der auf die eine oder andere Art seit den 1990er Jahren an vielen Archivmaterialien vollzogen wurde. Die ästhetische Wahrnehmung, die Aufschub ermöglicht, resultiert aus einer Unschärfe oder Unmöglichkeit der eindeutigen Prädikation des verwendeten Materials, die in den Zwischentiteln adressiert wird. Alle Versuche einer konsistenten Interpretation durch das Publikum misslingen und geraten aufgrund von Premediationen und Vorwissen, aber auch durch die widersprüchlichen Interpretationsangebote in den Texttafeln ständig in neue Krisen. Bubner fasst diese Kunstwerken eigene Unbestimmbarkeit in seiner Analyse von Kants reflektierender Urteilskraft wie folgt zusammen:
Die gewohnt bestimmende Tätigkeit [des Urteilens] scheitert an Kunstphänomenen […] Sie [die Urteilskraft] bewegt sich zwischen einem unbestimmbaren Besonderen und einem nicht verfügbaren Allgemeinen hin und her, und in dieser Schwebe wird die vermittelnde Bewegung ästhetisch gerade aktiviert.[1]
Bubner formuliert im Folgenden, auf Kant aufbauend, die Grundlagen einer kognitiven Kunsttheorie. Einen ähnlichen Ansatz findet man bei Martin Seel[2] und bei Dirk Pilz.[3] Pilz präzisiert Kants Definition in seiner literaturwissenschaftlich orientierten, objektiv-hermeneutischen Ästhetiktheorie dahingehend, dass die Versuche der Prädikation nicht zwischen dem unbestimmbaren Besonderen und dem nicht verfügbaren Allgemeinen, sondern zwischen zwei (oder mehr) anscheinend gleichermaßen gültigen Bestimmungen hin- und herspringt, sodass Prädikation und Imagination in einen nicht abschließbaren Prozess der gegenseitigen Verweisung geraten. Seel wendet eine ähnliche, ebenfalls rezeptionsorientierte Theorie auf die »ästhetische Erfahrung im Filmerleben« an und konstatiert, dass diese Erfahrung selbst nicht objektiv bestimmbar, sondern nur als Potenzial identifizierbar sei.[4] Worin genau besteht nun dieses Potenzial bei Aufschub? Zwischen welchen Prädizierungen oder Gegenstandsbestimmungen oszilliert hier die Wahrnehmung? Die Irritation, die Aufschub auslöst, resultiert aus der Inanspruchnahme eines Archivfilms aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs als Quelle, mithin eines Filmmaterials, das längst Teil eines Historisierungsprozesses und somit Teil der visual history geworden ist. Die aus dieser Quellenanalyse notwendigerweise resultierenden kognitiven Widersprüche sind die Bedingungen der anvisierten ästhetischen Wahrnehmung. Auch wenn dieser Historisierungsprozess ein typisches Phänomen der Auseinandersetzungen in den 1990er Jahren ist, offenbart sich erst in Farockis Darstellung das eigentlich Paradoxe dieser Praxis. Farocki bringt die Bilder aus Westerbork, die seinem Publikum vage aus Holocaust-Dokumentarfilmen vertraut sein dürften, als Dokumente des Lagers in einen Dialog mit der visual history des Holocaust oder der Holocausterinnerung, für die das Westerborkmaterial ebenfalls eine Bedeutung hat. »Bilder, die wir aus anderen Lagern kennen, überlagern die aus Westerbork« konstatiert eine der Titelkarten. Die im Gras ausruhenden Zwangsarbeiterinnen werden von den herumliegenden Leichen in Bergen-Belsen überlagert; weiße Kittel im Lagerlabor erinnern an Menschenversuche in Auschwitz und Dachau, und die Verwertung von Kabeln an die Verwertung der Körper der Internierten in Auschwitz. Farocki thematisiert also die Premediation bzw. das selektive Bildergedächtnis, mit der bzw. mit dem sein Publikum die Westerborkbilder wahrnimmt, und regt zum Nachdenken darüber an, wie stark solche Erwartungen deren Wahrnehmung strukturieren. Er fordert damit auch einen Blick auf die konkret in den Bildern eingefangene Fallstruktur des Lagers ein. Was dort zu sehen ist, steht im Widerspruch zu diesen Erwartungen. Farocki hält diesen Widerspruch aus und verstärkt ihn sogar noch, indem er gerade die Bilder zeigt, die der Holocaustdiskurs normalerweise nicht verwendet. Mit »Diese Bilder werden kaum je gezeigt« verortet er seinen Kunstfilm zwischen den kollektiven Gedächtnissen und der Fallstruktur, die in den Westerborkeinstellungen eingefangen ist, und betont deren dokumentierenden Charakter. Dadurch verstärkt Farocki aber genau genommen nur einen Wahrnehmungseffekt, der sich auch bei den Verwendungen in Dokumentarfilmen einstellt und der sich bei der genaueren Untersuchung von Archivfilmen fast zwangsläufig ergibt: Bestimmte Details der dargestellten Fallstruktur widersprechen den allgemeineren Geschichtsbildern. Die lachenden Deportierten, die ihre Waggons selbst schließen, konterkarieren unsere Vorstellungen von den Deportationen. Statt diese kognitive Dissonanz erklärend aufzulösen, fordert Farocki sein Publikum also auf, diesen Widersprüchen nachzuspüren. Indem er immer wieder Personen im Material identifiziert und anhand von Details das Datum der Abfahrt ermittelt, zeigt er, wie reich an konkreten Informationen das Material eigentlich ist und wie sich diese gerade aus den auf den ersten Blick widersprüchlichen Momenten erschließen lassen. Damit fordert er das Publikum auf, aktiver und kritischer auf das Material zu schauen. Schließlich kommt er wieder zu den unerklärlichen Momenten und begründet diese in einer die Internierten ermächtigenden Geste als Teil einer aktiven Überlebensstrategie. Damit stellt Farocki der ansonsten viktimisierenden Holocausterinnerung ein aktives, fast heroisches Narrativ entgegen, das er bezeichnenderweise aus einem Archivmaterial gewinnt, das gerade für die empathische, aber eben auch viktimisierende Holocausterinnerung konstitutiv war und ist. Auch diese Spannung birgt das Potenzial einer ästhetischen Erfahrung, lässt die Wahrnehmung kurzzeitig in eine Krise geraten. Die Entdeckungen, die Farocki präsentiert, wie die Bestimmung des Datums der Deportation anhand des Koffers der Frouwke Kroon oder die geänderte Aufschrift auf dem Waggon der Settela, sind eigentlich Leistungen von Broersma und Rossing bzw. von Aad Waagenaar.[5] Anders als beispielsweise in seinem früheren Film Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1989) deckt Farocki solche Vorarbeiten hier nicht auf. Er präsentiert dabei die in Kamp Westerbork gefilmd zusammengetragenen Vermutungen unkritisch als eine Art abgesichertes Hintergrundwissen und trägt leider zu einer Affirmation dieser teilweise fragwürdigen Thesen bei. Das Lager Westerbork und Settela, Gezicht van het Verleden dienen ihm als Vorlagen, deren Bestandteile Farocki selektiv zu einer neuen Erzählung amalgamiert. In der auf die Veröffentlichung des Films folgenden Diskussion wird vieles davon als historisches Wissen unhinterfragt weitergegeben. Farocki kennt Duyns’ Film und auch Aad Wagenaars Buch Settela, was auf einen Austausch mit Thomas Elsaesser 2006 zurückgeht.[6] Er lässt das Material für sich sprechen, indem er auf eine Tonebene verzichtet und den Fluss der Laufbilder nur durch kommentierende Texttafeln unterbricht. Die Legitimation der Darstellung der Settela durch Cherry Duyns’ Film Settela, Gezicht van het Verleden und die sukzessive Ausweitung auf das gesamte Material durch das Breslauernarrativ werden von Farocki noch einmal verstärkt. Dabei geht er aber keineswegs beliebig, wenn auch ein wenig fahrlässig vor. Fahrlässig, da er in Kauf nimmt, dass diese kaum abgesicherten Hypothesen sich damit weiter verfestigen. Alles andere als beliebig, da er mit seinen quasi-investigativen Narrativierungen eine Infragestellung der Viktimisierung der Holocausterinnerung verfolgt. Diese Geste der Ermächtigung ist das eigentliche politische Ziel von Farockis Befassung mit dem Holocaust in Aufschub.
Aufschub gilt gemeinhin als gelungene künstlerische Näherung an historisches Filmmaterial.[7] Die Kontextualisierung des Materials und seine Präsentation wird als neuer Weg der künstlerischen Auseinandersetzung mit historischem Filmmaterial und als begrüßenswerter Ansatz der Vermittlung historischer Zusammenhänge gewürdigt. Sachhaltigkeit spielt bei dieser Beurteilung eine untergeordnete Rolle, bzw. deren Fehlen wird, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt. Es haben sich aber ein paar Ungenauigkeiten in die Zwischentitel eingeschlichen, und angesichts der Bedeutung die Aufschub bis heute v. a. in den Memory Studies zugeschrieben wird, scheint mir ein kurzer Verweis auf diese gerechtfertigt. Manche der Fehler hängen mit falschen Angaben in den Quellen zusammen, die Farocki konsultierte, aber Einiges ist Ergebnis seiner kreativen Interpretationen. So ist die Fliegende Kolonne[8] keine Lagerpolizei. Der Funktion einer Polizei im Lager am nächsten kommt der Ordnungsdienst von Arthur Pisk, der ursprünglich aus der Lagerfeuerwehr hervorgegangen ist. Die Deportationszüge gehen nicht nur dienstags ab,[9] und der im Film gezeigte Deportationszug verlässt Westerbork an einem Freitag. Mit dem Zug werden 936 und nicht 691 Personen deportiert, wie Farocki konstatiert. Im Durchschnitt werden pro Transport um die 1000 Personen deportiert. In den Zwischentiteln erfährt man: »Hier die Wäscherei für die über 10.000 Internierten«. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hat Westerbork noch rund 3000 Internierte (17. April 1944: 3.020, 23. Mai 1944: 2.945),[10] zwischen November 1942 und Januar 1944 schwanken die Zahlen zwischen durchschnittlich 7.000 und 9.500. Deutlich über 10.000 Internierte hat Westerbork nur dreimal für sehr kurze Zeit. Das Lager ist für knapp 6.000 Personen ausgelegt. Bei der genaueren Analyse der Bilder von der Deportation wird konstatiert, die Einstellung mit Settela sei die einzige Nahaufnahme im Film und Breslauer habe aufgrund der traurigen Wirkung keine weiteren solchen direkten Blicke zu filmen gewagt. Das Westerborkmaterial enthält jedoch eine ganze Reihe weiterer Nahaufnahmen und es lassen sich mehr als 60 Blicke direkt in die Kamera feststellen. Diese Form der Darstellung ist also eher typisch für das Filmmaterial. Eine zweite Gruppe von Ungenauigkeiten sind irreführende Behauptungen, die zu gröberen Fehleinschätzungen führen. Zu diesen weitreichenden Missverständnissen zählt Farockis Spekulation über die Darstellung der arbeitenden Juden, die den größten Teil seines Films einnimmt. Im Abschnitt über die Landwirtschaft gibt es eine kurze Montage, in der wir erst ein Pferd sehen, das eine Egge zieht, und direkt darauf zwei Juden, die nun das Pferd ersetzen. Die dazugehörigen Tafeln: »Soll heißen: wir sind eure Arbeitstiere« und »Wir machen die Arbeit, die sonst Tiere und Maschinen tun«. Das Bild der Arbeiter, die als Zugtiere dienen, ist jedoch aus der NS-Propaganda bekannt und möglicherweise sogar ein versteckter, ironischer Hinweis des Westerborkfilmteams auf den propagandistischen Hintergrund seiner Auftragsarbeit. So gibt es in der Arbeiter-Illustrierten-Zeitung vom 20. Juli 1933 einen Bericht über »Fotos von Häftlingen vor Pflug, bewacht von SS-Männern mit Schäferhund«[11] mit der Bildunterschrift »Arbeiter als Zugtiere!«. Farocki entgeht aber vor allem ein anderer wichtiger Punkt bei der Darstellung der Arbeit. Die Titel »Es galt zu beweisen, wie nutzbringend das Lager war«, »Die Internierten von Westerbork fürchteten das Lager werde bald aufgelöst«, »Diese Filmaufnahmen sollten das Verhängnis abwenden«, »Die Bilder sollten sagen: das Lager nicht auflösen, die Arbeiter nicht deportieren!« nehmen eine naive Haltung ein, die weder eine konsistente Erklärung der Filmbilder liefert noch mit der Realität des Lagers zusammenpasst. Wer in den Betrieben oder in der Landwirtschaft eine Arbeitsstelle hat, ist dadurch von den Deportationen bis auf weiteres befreit, jedenfalls solange es ausreichend ungeschützte, zum Transport zur Verfügung stehende Jüdinnen und Juden im Lager gibt. Denn statt der gesperrten werden eben andere deportiert. Daher ziehen in der Landwirtschaft Juden eine Egge, obwohl es dafür Pferde gibt. Diese Arbeit ist aber nicht in einem produktiven Sinne nutzbringend, sondern funktioniert lediglich als Deckvisualisierung. Die Arbeit hat auch keine generell aufschiebende Wirkung, sondern bewirkt nur eine andere Reihenfolge der Deportationen. Internierte mit guten Beziehungen werden später deportiert und wer diesen Aufschub bis zum Kriegsende durchhalten kann, überlebt. Aufschub heißt also nur: andere vorschicken. Farockis Behauptung, die Internierten in Westerbork hätten Angst vor der Schließung des Lagers gehabt (»Die Insassen von Westerbork fürchteten, das Lager werde bald aufgelöst«) insinuiert eine Kontinuität der Belegschaft, die es, wie in Kapitel 5 dargelegt wurde, nicht gab. Die im Film abgelichteten Arbeiter:innen hatten ihre Posten erst wenige Wochen vorher bekommen. Ihre Vorgänger:innen waren erst kürzlich deportiert worden. Farockis Idee einer Ermächtigung der Internierten ist nachvollziehbar und ein interessanter Deutungsfilter. Sie lenkt aber auch von der eigentlich inhärenten Bildpolitik ab. Anders als bei der Analyse der Bilder aus Litzmannstadt durch Koch[12] findet bei Farocki keine Dekonstruktion des Täterblicks statt. Gemmeker liefert mit dem Film, ähnlich wie Genewein mit seinen Farbdias aus Litzmannstadt, einen Leistungsbericht seiner Mitarbeit an der »Endlösung«. Die Juden zum Schein arbeiten zu lassen und die damit verbundene Ausbeutung und Diskriminierung ist Gemmekers genuiner Beitrag zur antisemitischen Politik der deutschen Besatzungsmacht und diesen Beitrag dokumentiert er mit seinem Film. Eine sachhaltige Interpretation der im Film festgehaltenen Zusammenhänge kommt um diese Wahrheit nicht herum.
Die in Aufschub vorgenommenen Narrativierungen unterscheiden sich von denen, die in Pressers Die Nacht der Girondisten oder in Boulevard des Misères von Boas zu finden sind. Presser und Boas geht es darum, die im Lager virulenten Macht- und Motivstrukturen offenzulegen. Sie wollen verdeutlichen, wie verschwommen die Grenzen zwischen Täter:innen, zwangsweise Beteiligten und Opfern sind. Bei Farocki wird die Kollaboration, die ja auch im Anfertigen eines Filmes liegt, gar nicht thematisiert und damit stellt er die Internierten auch als Personen ohne Vorstellung einer Zukunft dar. Aber die Internierten ahnen, was sie im Osten erwartet und sie leiden gleichzeitig unter einer als Schuld wahrgenommenen Teilnahme, am Film und an der vorgetäuschten Arbeit. Sie antizipieren eine Nachwelt, die sie mit verunsicherten Blicken in die Kamera adressieren. Hinzu kommt, dass diese Art der freundlichen Kooperation von der Lagerleitung erwartet wird und Nichtkooperation mit Straftransport geahndet werden kann, die gefilmten Internierten hier also unter Zwang freundlich in die Kamera blicken. Indem Farocki so tut, als wäre die verstörend heile Welt, die da gezeigt wird, nur der Naivität der Internierten geschuldet, wehrt er die Möglichkeit ab, dass wir womöglich selbst Adressat:innen dieser Bilder sind. Die Gefilmten fragen sich: Wer wird sich den Film anschauen? Und: Wird man später noch verstehen, in was für einer Zwangslage wir uns befinden? Auch die Bilder der Sonderkommandos aus Auschwitz von Alberto Errera meinen die Nachkriegsgenerationen. Das betrifft Täter:innen wie Opfer. Auch Gemmeker hat eine Vorstellung von einer Gesellschaft nach dem »Dritten Reich«, der er sich erklären will.
Obgleich Aufschub einer historiografischen Überprüfung also nicht standhält, ist die von Farocki vorgenommene Gegenüberstellung in erinnerungstheoretischer Perspektive fruchtbar. Das in seinen Rekonstruktionen sichtbar werdende travelling memory, aber auch die in den Texttafeln manifeste Ambivalenz der Bildinterpretation regen zur erneuten Befragung des Materials an und vermeiden gerade eine auf Abschluss abzielende, rein historiografische Befassung mit dem Filmgedächtnis des Westerborkfilms. Farocki verwendet 69 Einstellungen von den Zügen, wobei er einige mehrfach zeigt. Der immer wieder geäußerte, aber falsche Eindruck, Aufschub zeige das gesamte Material,[13] ist der ausgiebigen Verwendung der Bilder aus den anderen Rollen von den Werkstätten und dem Sport geschuldet, die immerhin 17 Minuten (zwei Montagen) des knapp 40-minütigen Kurzfilms ausmachen. Zieht man Einführung und Abspann ab, so bleiben 19 Minuten, in denen Farocki die neun Minuten der Züge mehrfach wiederholt, während von den verbleibenden 71 Minuten Westerborkmaterial weniger als ein Viertel gezeigt wird (24 % abzüglich der Zwischentitel). Interessant ist daher auch weniger, was Farocki zeigt, sondern was er weglässt. Das sind zum Beispiel die ikonischen Totalen vom abfahrenden Zug, die sich seiner ambivalenten Lesart offenbar entziehen. Vor allem aber fällt auf, dass Farocki keine Einstellungen vom zweiten Zug verwendet. Die häufige Verwendung dieser Einstellungen für die Ankunft in Auschwitz scheint hier implizit respektiert zu werden. Was auch immer die wirklichen Gründe gewesen sein mögen, so trägt die Abwesenheit dieser Einstellungen in Aufschub weiter zu ihrer Abtrennung vom restlichen Westerbork-Korpus bei. Aufschub verwendet die Statistiken aus dem Restmaterial in Rolle F1014, was darauf hindeutet, dass das vorhandene Material von Farocki komplett gesichtet wurde. Bei der Montage der Einstellungen aus der vierten Rolle ist Farocki etwas gelungen, was er selbst nicht kommentiert und offenbar übersehen hat. Die Frauen beim Ausruhen nach dem Säen sind dieselben wie die danach eingeschnittenen Frauen bei den Maurerarbeiten aus einem späteren Teil des Films. Farocki montiert sie daher zu einer Sequenz zusammen. Diese Montage legt offen, dass die Dreharbeiten an den verschiedenen Stationen außerhalb des Lagers mit immer demselben Trupp von Arbeiterinnen durchgeführt wurden. Es handelt sich bei den Einstellungen mit landwirtschaftlicher Arbeit also um gestellte Aufnahmen.
Fußnoten
[1] Rüdiger Bubner: Ästhetische Erfahrung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S 36
[2] Vgl. Martin Seel: Was geschieht hier? Beim Verfolgen einer Sequenz in Michelangelo Antonionis Film Zabriskie Point. In: Stefan Liptow, Martin Seel (Hg.): Kunst und Erfahrung. Beiträge zu einer philosophischen Kontroverse. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2012, S. 181–194.
[3] Vgl. Dirk Pilz: Krisengeschöpfe. Zur Theorie und Methodologie der Objektiven Hermeneutik. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag 2007.
[4] Vgl. Seel: Was geschieht hier?, S. 186.
[5] Sylvie Lindeperg weist mehrfach darauf hin, das diese Entdeckungen bereits in Settela, Gezicht van het Verleden (1994) dokumentiert sind, u. a. Sylvie Lindeperg: Suspended lives, revenant images. In: Antje Ehmann, Kodwo Eshun (Hg.): Harun Farocki: Against what? Against whom? London: Koenig Books 2009, S. 60, Fn 9.
[6] Thomas Elsaesser äußert sich in seinem Katalogbeitrag anlässlich der Ausstellung von Aufschub verwundert darüber, dass weder Aad Wagenaar noch Cherry Duyns im Film erwähnt werden und verweist auf eine Kritik auf Farockis Website, in der diese Entdeckungen sogar fälschlicherweise Farocki selbst zugeschrieben werden, vgl. Thomas Elsaesser: Holocaust Memory and the Epistemology of Forgetting? Re-wind and Postponement in Respite. In: Antje Ehmann, Kodwo Eshun (Hg.): Harun Farocki: Against what? Against whom? London: Koenig Books 2009, S. 58.
[7] Vgl. Sven Kramer: Reiterative Reading: Harun Farocki’s Approach to the Footage from Westerbork Transit Camp. In: New German Critique 41, Issue 3 (2014), S. 35–55; Sylvie Lindeperg: Suspended lives, revenant images; Elsaesser: Holocaust Memory and the Epistemology of Forgetting?.
[8] TC 00:02:08:00 »FK = Fliegende Kolonne, eine Einheit der Lagerpolizei«.
[9] TC 00:14:38:00 »Am Dienstag Vormittag ging der Zug von Westerbork ab«.
[10] NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (Amsterdam).
Collection NIOD 250i (Westerbork, Judendurchgangslager), Dokument 147, 157.
[11] Habbo Knoch: Die Tat als Bild. Hamburg: Hamburger Edition 2001, S. 86, Fn 97.
[12] Vgl. Gertrud Koch: Die Einstellung ist die Einstellung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1992, S. 176.
[13] Lediglich Kramer: Reiterative Reading, S. 44 relativiert diese Annahme, wenn er feststellt, dass Farocki allein aufgrund der Länge seines Films nur Teile des Westerborkmaterials zeigt, »although the general impression and the overarching gesture of the film both suggest the faithful transmission of the only surviving footage from Westerbork«.
11.08.2025 — Rosa Mercedes / 06